Ein informationshaltiges Environment
In welchem wir die Einflüsse von
Magie und Marihuana in Orsons Touch of Evil
untersuchen
Your methodology sucks!
– Cannibal Woman Of The Avocado Jungle Of Death
It’s okay – we’re on the side of freedom and justice.
– Steelyard Blues
Kritiker haben in endloser Weise die Eröffnungssequenz von Orson Welles‘ Touch of Evil (1958) analysiert und hoch gelobt. Dennoch kann man auch heute noch in ihr, wie bei jeder neuen und gewagten Kunst, immer wieder Dinge finden, die einen aus der Fassung bringen. Zum Beispiel enthält sie einen magischen Trick, den kein Interpret bislang entdeckt hat.
Die Eröffnungsszene dient dazu, unsere konditionierten Erwartungen zu verwirren – wie „eine Reorganisation der Wahrnehmungsdaten zur Täuschung der Zuschauer“ (wie Terry Comito in der Einleitung seines Buches schrieb). Präziser gesagt, katapultierte Welles den Zuschauer in einen stoned-out space. In einem Film über Drogen und Grenzüberschreitungen nutzte Welles die erste Szene, um das Publikum über eine Grenze hinaus in die psychedelische Welt zu befördern.
Um das zu erläutern:
1) Die ganze Aufnahme dauert 2 Minuten und 15 Sekunden und überschüttet das Publikum mit so vielen Informationen, dass ein gewöhnlicher Regisseur ungefähr 20 Einstellungen gebraucht und sie dann zusammen geschnitten hätte, um den Inhalt der Sequenz darzustellen. Doch die Montage an sich ist, wie Jean Collet geschrieben hat, immer „propagandistisch“ und „brutal“, sie führt die Wahrnehmung des Publikums beharrlich in einen vorher erzeugten Realitätstunnel. Jede Kamerafahrt von Welles jedoch – mit den Schauspielern, die sich in verschiedene Richtungen bewegen und der Kamera, die wie nervös um sie herum fährt – arbeitet gegen diese totalitäre Tendenz und propagandisiert auch nicht. Es regt den Zuschauer vielmehr an, selbst zu entscheiden, welche Elemente wichtig sind und wie man sie zu einer kohärenten „Bedeutung“ aufeinander bezieht.
2) Zu keinem Zeitpunkt der 135 Sekunden erlaubt es Welles der Kamera, das zu tun, was die französischen Regisseure des New Wave le plain Américain nennen – die typische Hollywood-Aufnahme, bei dem die Kameralinse in Augenhöhe eines „objektiven“ Zuschauers ein paar Meter von der Handlung entfernt steht.
Le plain Américain grenzt den gewöhnlichen „Raum“ und die gewöhnliche „Realität“ ab, durch den uns die typischen Hollywood-Regisseure darauf trainiert haben, Raum und Realität wie sie selbst zu sehen. Welles versetzt dich in einen kontingenten Raum, der sich kontinuierlich neu definiert (nach der Art und Weise der besten Arbeiten von Picasso oder Elmyr, oder wer auch immer die kubistischen Bewusstseins-Brocken der bedeutenden 20er Jahre gemacht hat.)
3) Insbesondere montierte Orson die Kamera auf einen 6,5 Meter-Kran, um die Informationen von 20 Einzelaufnahmen in eine einzige flüssige Kamerabewegung zusammenzufassen. Die Kamera geht niemals dahin, wo wir es erwarten, sondern immer dorthin, wo es uns überrascht.
Wie auch Marihuana erzeugt diese lange Aufnahme von Welles einen Informationsüberschuss und provoziert einen dazu, den eigenen Realitätstunnel zu erweitern, um all die Informationen zu verarbeiten. Die Montage und le plain Américain versetzt einen dagegen in eine Art Trance. Welles‘ Manöver aber rüttelt einen auf fast gewalttätige Weise wach. Wild und ungemütlich zwischen Komödie, Melodram und Tragödie vor und zurück taumelnd, betrachtet Touch of Evil Drogenfahnder (und andere Cops) wie mit berauschten Augen und erschuf zwei Jahre, bevor die 60er begannen, etwas, das heute wie der archetypische Film der 60er Jahre aussieht.
4) Welles benutzte für diesen Film natürlich seine geliebte 18.5 mm Linse, die einen ungewöhnlich weiten Winkel und einen tiefen Fokus ermöglicht. Das erzeugt jene „Mischung aus Realismus und Surrealismus“ (wie es ein BBC Kommentator einmal genannt hat), die wir aus dem Welles’schen Kino kennen.
In realistischer Hinsicht bringt die 18.5 mm Linse den Hintergrund in einen schärferen Fokus und näher an das heran, was die Augen in der gewöhnlichen, nicht-filmischen Welt sehen. Sie erlaubt Welles, einem Möchtegern-Maler in seiner Pubertät, jede Aufnahme in seinem grandiosen kompositorischen „Maler“-Stil zu färben.
In surrealistischer Hinsicht versetzt uns die 18.5 mm Linse aber in das, was ich einen „stoned space“ nenne. Wenn mathematisch betrachtet der Schauspieler bei einer normalen Hollywood Linse drei Schritte vorwärts geht, scheint er dementsprechend auch auf der Leinwand drei Schritte vorwärts zu gehen. Mit der 18.5 mm Linse bewegt er sich im filmischen Raum in relativistischer Weise aber 9 Schritte näher an das Publikum heran und scheint sich unheilvoll – oder manchmal lächerlich – zu vergrößern. Diese Mischung aus „schärfer-als-üblich“-Fokussierung in einem nicht-euklidischen, relativistischen Raum scheint mir die beste cinematische Darstellung einer psychedelischen Wahrnehmung zu sein.
Es gibt das Vorurteil, dass die „normale“ kleinwinklige Linse „Realität“ besser abbilden kann als die 18.5 mm Linse oder dass die menschlichen Augen die „Realität“ besser sehen können als die des Hundes. Doch dies repräsentiert nur die Art des kulturellen Chauvinismus, die postmoderne Kunst zu unterwandern versucht. Durch sie lernen wir, aus unterschiedlichen Blickwinkeln schauen zu können. Wie der Barde der Lambs and Tygers sagte, müssen wir hinter die „Single Vision and Newton’s Sleep“ schauen.
(Ja, tatsächlich hat Welles das böse Kraut zumindest hin und wieder gebraucht. Die Jazz-Sängerin Billie Holliday erzählte einmal, dass sie und Orson davon eine Menge geraucht haben, während er Citizan Kane drehte. Siehe ihre Autobiografie Lady Sings the Blues)
Um noch tiefer in den stoned-out space der ersten 135 Sekunden von Touch of Evil einzudringen: Ominöse Musik (Rock ’n Roll-artig mit einem metallischen tick-tack Beat) beginnt, bevor wir überhaupt etwas sehen. Die Kamera blendet auf in einer Halbtotalen auf eine Zeitbombe in den Händen eines Mannes. Wir sehen den Anzug und das Hemd des Attentäters, aber nicht sein Gesicht. Das betrunkene (oder verrückte) Gelächter einer Frau „verursacht“, dass die Kamera nervös nach links schwenkt, und wir sehen einen betrunkenen Mann und eine Frau, die uns entgegenkommen. Die Kamera schwenkt furchtsam herum, schaut hierhin und dorthin und versetzt uns in die Perspektive des Attentäters. Der Attentäter rennt los und die Kamera folgt ihm, bis er die Bombe am Boden des Autos befestigt hat. Von jetzt an bis zum Ende der Aufnahme erinnert uns das Ticken der Bombe in der Musik an die drohende Gefahr.
Die Kamera hat sich derweil zurück bewegt und der Mörder rennt davon, flüchtend, doch die Kamerafahrt wurde beschleunigt, und jeder Kommentator hat scheinbar übersehen, was der Magier Welles gerade getan hat. (Wir werden darauf zurückkommen.) Die „zurückweichende“ Kamera – als würde sie versuchen, von der Bombe weg zu kommen – steigt hoch hinauf, als sie den Ort des Geschehens beim Parkplatz verlässt. Wir erhaschen einen Blick auf den Mann und die Frau, die in das Auto steigen und es starten. Die Kamera „verliert“ sie schließlich aus dem Blick, als sie losfahren, schwenkt nach links über das Dach eines Gebäudes, erfasst sie dann kurz wieder aus der Distanz in einer Gasse, verliert sie, findet sie wieder und bleibt bei ihnen bis zum Ende der Aufnahme. Die Musik erinnert uns dabei immer an die Bombe.
In der Zwischenzeit finden wir uns inmitten des „unübersichtlichen Labyrinths“ (Terry Comitos Ausdruck) von Los Robos wieder, eine Grenzstadt, die Amerika und Mexico verbindet. Miguel Vargas, ein mexikanischer Drogencop (Charlton Heston) und seine neue Frau Susan (Janet Leigh) zeichnen sich als schattenhafte Figuren ab, treten kurz ins Licht und dann wieder in den Schatten, so dass wir sie kurz aus den Augen verlieren. Die Kamerabewegung verlangsamt sich, um dem Auto zu erlauben, sich uns und den Vargases zu nähern, beschleunigt wieder und lässt sie zurück. Zwei amerikanische M.P.s erscheinen als Statisten. Ein Dutzend mexikanische und amerikanische Fußgänger erscheinen ebenfalls im Bild. Dann „finden“ wir plötzlich das Auto wieder. Andere Autos fahren an der Kamera vorbei, ein alter Mexikaner schiebt einen Gemüsewagen und Müll wirbelt über die Straße. Wir sehen billige Strip-Clubs, Bars und das unvermeidliche JESUS SAVES an einer Missionsfassade. Zu keiner Zeit bewegt sich jemand direkt und konstant auf die Kamera zu oder von ihr weg. Zwischen 50 und 70 Statisten bewegen sich in unterschiedliche Richtungen, aus schrägem Winkel von oben mit der Kamera eingefangen, bis wir plötzlich in einem vergleichsmäßig „normalen“ cineastischen Raum sind – gerade zu dem Zeitpunkt, als die Vargases und das Auto simultan (synchron?) an der Grenze erscheinen.
Das Ticken unter der Musik steigt um ein paar Dezibel an. Wir haben nun den „Helden“ und die „Heldin“ erkannt. Sie stehen nur ein paar Meter entfernt von der Bombe, in tödlicher Gefahr, derer sie sich nicht bewusst sind.
In dem Moment nachdem wir die Grenze überschritten haben, verlässt die Kamera das Auto wieder und folgt den Vargases, und wir beginnen durch ihre Unterhaltung miteinander etwas über sie zu erfahren. Susan, ein „gutes Mädchen“ aus Philadelphia, hatte den Mut, einen Mexikaner zu heiraten. Doch sie enthüllt auch unachtsam einen latenten Rassismus. Miguel erscheint überfürsorglich – ein Charakterzug, den er beibehalten wird (ironischerweise – da er später durch seinen Job abgelenkt wird, versagt er vollkommen darin, sie zu beschützen, als sie ihn wirklich braucht). Als sie innehalten, um sich zu küssen, endet die 135 Sekunden Aufnahme damit, dass die Bombe gewaltig explodiert – jedoch offscreen (wir sehen nur das reflektierte Licht, nicht die Explosion selbst).
Die Geschichte, die sich dann entwickelt (insofern wir dieses „unübersichtliche Labyrinth“ in einem konventionellen Sinne in Form einer Geschichte reduzieren können), wird dann zu einem tödlichen Wettstreit zwischen Vargas (Heston), einem „guten“ Drogen-Cop, der sich an die Regeln hält, und Captain Hank Quinlan (Welles), einem rassistischen Polizisten des Morddezernats und einem trockenen Alkoholiker, der seiner mystischen „Intuition“ folgt.
In einer Schlüsselszene – eine weitere 200 Sekunden-Aufnahme (drei Minuten und 20 Sekunden!), vollzieht Welles seinen zweiten magischen Trick. Welles lässt ein Dutzend Schauspieler in einem kleinen Appartement zwischen Wohnraum, Schlafzimmer und Bad hin und her gehen. Sie streiten sich untereinander (in typischer Welles’scher Manier) und gängeln den Mieter des Appartements, einen gewissen Manolo Sanchez (Victor Milan), den Hauptverdächtigen des Bombenanschlags.
Quinlans Rassismus und Vargas‘ Ablehnung erhitzen sich gegenseitig. Sanchez verteidigt leidenschaftlich und eifrig seine Unschuld. Als die Schauspieler aufgeregt in den Räumen umhergehen, folgt die Kamera einem Schauspieler der Gruppe, um dann nervös wieder zurück zu kommen und zu sehen, was bei der anderen Gruppe geschieht. In dieser Verwirrung geschehen wichtige Dinge offscreen (wir hören zum Beispiel, wie Quinlan Sanchez schlägt, sehen es aber nicht). Das wichtigste Ereignis kann man jedoch nicht nur nicht sehen, sondern es bleibt auch den Mikrofonen verborgen. Während Sanchez uns mit seinen Unschuldsbeteuerungen und den Schwüren auf das Grab seiner Mutter ablenkt, versteckt nämlich irgendjemand zwei Dynamitstangen im Badezimmer, so dass ein weiterer Cop diese später finden und Sanchez damit verhaften kann.
Der Rest des Films besteht in Vargas‘ Versuch, zu beweisen, dass Quinlan das Dynamit versteckt und den Mexikaner reingelegt hat. Quinlan versucht dagegen, Vargas zu diskreditierten und ihm Marihuana- und Heroin-Missbrauch nachzuweisen. Vargas, trotz seines Liberalismus klug und stark, kämpft energisch dagegen an. In lediglich 24 Stunden kollabiert schließlich Quinlans Welt. Neu überprüfte Beweise stellen nicht nur einige, sondern die meisten von Quinlans Verhaftungen in Frage, die er in den 30 Jahren seines Polizeidienstes vorgenommen hat. Als sich die Falle schließt, beginnt er nach 12 Jahren der Abstinenz wieder zu trinken und endet damit – volltrunken, verzweifelt und erbärmlich –, dass er seinen Partner tötet, einen Cop, der ihn verehrte und glaubte, dass seine „Intuition“ ein übernatürliches Element in sich trug.
Der Liberalismus – wie in vielen „normalen“ Hollywoodfilmen – triumphierte über den Faschismus und wir können uns alle warm und geborgen fühlen.
Dann zieht uns Welles den Boden unter den Füßen weg. Sanchez gesteht, dass er die Bombe gelegt hatte. Quinlan hatte also dennoch eine verlässliche Intuition – zumindest teilweise. Mit Unbehagen bemerken wir in der Retrospektive, dass der liberale Vargas in dem Versuch, sich einen Weg aus den Drogenanschuldigungen zu kämpfen, in steigendem Maße Quinlan-ähnliche Taktiken gebraucht hat. Welles untergräbt damit noch mehr unseren Glauben an moralische Konventionen von Good Guy/Bad Guy-Thrillern.
Wir finden zu keinem Zeitpunkt des Films heraus, wie viele von den Leuten, die Quinlan verleumdet hat, tatsächlich die Verbrechen begangen haben, für die sie verhaftet wurden – genauso, wie wir nie die exakte Position eines Quantenpartikels bestimmen können oder wie viele Picassos wir eigentlich Elmyrs nennen müssten. Die Postmoderne entstammt nicht einer Laune, sondern den zunehmenden Beweisen dafür, dass wir einfach nicht in einem aristotelischen Universum von wahr und falsch leben. Wie UMMO sagt, so leben wir mit dem ausgeschlossenen Dritten.
Amüsanterweise haben sich einige Interpreten, besonders in Frankreich, dagegen gewehrt, Sanchez‘ Bekenntnis Glauben zu schenken. Sie wollten offenbar eine einfache Moralgeschichte. Solche Kritiker übersehen den magischen Trick der ersten 135 Sekunden. Wenn du dir den Film noch mal auf Video anschaust und diese Szene wiederholst, so kannst du dich davon überzeugen, dass Sanchez tatsächlich die Bombe gelegt hat. Wir sehen nämlich nicht nur sein Hemd und seinen Anzug, sondern auch für einen sehr kurzen Moment einen Teil seines Gesichtes von der Seite. Aber dadurch können wir ihn identifizieren. Welles, mit der Selbstsicherheit eines Mannes der seit seiner Kindheit Bühnenmagie geübt hat, erlaubt es Sanchez (Victor Milan) sogar, denselben Anzug und dasselbe Hemd wie bei der Eröffnungssequenz zu tragen, als wir ihn später wieder in seinem Appartement sehen. Der Magier weiß, dass der Beobachter in einer informationsüberladenen Situation nur das sieht, auf das er vorbereitet ist.
Welles‘ ambivalentes Konzept des menschlichen „Charakters“ stammt von Shakespeare, seinem Lieblingsautoren seit er neun Jahre alt war. Seine politische Haltung entsprang der antifaschistischen Bewegung der 30er Jahre. Diese Spannung zwischen shakespearescher graustufenartiger Ambiguität und idealistischer Schwarz/Weiß-Moral unterliegt all den Ironien und Ängsten, die Welles‘ Filmen ihren pessimistischen Humanismus verleihen. Nachdem Quinlan stirbt, zitiert eine Madam ein Epitaph – obwohl dies schon zitiert wurde, ist es wert, es nochmals zu erwähnen (da es unsere Beobachtungen nicht abschwächt, sondern die Unsicherheiten nur verstärkt): „He was a kind man. What does it matter what you say about People?“
In einem tieferen Sinne verfügt Touch of Evil über Aspekte eines magischen Tricks. Die meisten Interpreten stimmen darin überein, dass Quinlan zum Schluss, als er stirbt, unsere Sympathien gewonnen hat. Es bleibt eine Kuriosität, dass es Welles, der all die „Tricks“ kannte, einen Bösewicht sympathisch erscheinen zu lassen – und der den charmantesten Soziopathen, den man je gesehen hat in The Third Man selbst gespielt hat – systematisch vermied, eines der gewöhnlichen Mittel zu gebrauchen, um Quinlan menschlich erscheinen zu lassen. Selbst als Make-up-Künstler bei diesem Film auftretend, gestaltete er Quinlan so hässlich wie einen Zirkusfreak. Er polsterte seinen ohnehin schon korpulenten Körper auf, um eine obszöne Schlaffheit zu erzeugen. Streng kontrollierte er seinen unbezähmbaren Humor und gab Quinlan keine der geistreichen Sprüche, die er seinen anderen Bösewichtern gab. Insgesamt repräsentiert Quinlan das, was die Sechziger mit dem Wort „PIG“ gemeint haben.
Und doch, als Quinlan versucht, betrunken das Blut seines Partners von seinen Händen zu waschen – völlig unpassend in dreckigem, trüben Wasser –, treten wir in einem bösen, surrealistischen Sinne einer shakespeareschen Tragödie entgegen, die dieses rassistische Schwein zu einem fehlerbehafteten Helden erhebt. Wenn Quinlan dann tot in das selbe dreckige Wasser fällt, ist er inzwischen der Mittelpunkt des Films und Vargas, der konventionelle Held, zu einem Deus ex Machina geworden, der Maschine, die Captain Hank Quinlan zerstört. (Charlton Heston beschreibt Vargas in der BBC-Dokumentation Orson Welles: A Life in Film als „einen Zeugen“ der Tragödie Quinlans.)
Da Welles als Liberaler immer gesagt hat, dass er Quinlan verachtet – obwohl er in derselben Dokumentation auch sagte: „Every villain has his reasons“ –, so können wir doch nicht erklären, wie aus diesem Monster im letzten Drittel des Films ein tragischer Held wurde. James Naremore fand in The Magic World of Orson Welles einige „menschliche“ Aspekte in Quinlan, doch ich glaube nicht, dass er damit irgendjemand anderen als sich selbst überzeugen konnte. (Natürlich weiß jeder – sobald Quinlan auf die Leinwand kommt – dass dieses fette, lahmende Wrack, das von Alkohol und Fresssucht geplagt ist, eine schreckliche innere Verletzlichkeit besitzt. Wir können, sofern wir das wollen, annehmen, dass seine Süchte einen schrecklichen Selbstzweifel nahe legen, den er selbst niemals verbal ausgedrückt hat.)
Quinlan steht in der Reihe mit Macbeth und Othello und Lear einfach deshalb, weil Orson Welles ihn dahin gestellt hat. Und Welles vollbrachte dies ausschließlich mit dem „magischen Trick“ des künstlerischen Rhythmus‘. Die Struktur von Touch of Evil – die Teile des Uhrwerks, die ineinander einrasten und dadurch ein ästhetisches Ganzes ergeben – erzeugen ein tragisches Crescendo, das genauso klassisch ist wie Welles‘ Shakespeare-Verfilmungen (Macbeth, 1948; Othello, 1952; Chimes at Midnight, 1966). Quinlan dient als eine tragische Figur, denn die tragische Struktur des Ganzen – der abstrakten künstlerischen Form – erhebt ihn aus der schweinischen Welt in die Welt der Filmpoesie.
Eine der ersten Lehren des Marihuana: Die Welt beinhaltet zu viele Informationen, als dass sie in irgendein Modell passen könnten. Die zweite Lehre: Jedes Modell, das du erzeugst, verändert die beobachtbaren Informationen so lange, bis sie zu dem Modell passen. In den Augen eines Paranoikers erscheinen die besten Freunde als Mitglieder einer Verschwörung. Und betrachtet durch die Augen eines shakespeareschen Humanisten wie Orson Welles wird aus Hank Quinlan nicht nur ein stiernackiges rassistisches Schwein, sondern auch ein vergrößertes und verzerrtes Bild der Schwächen von uns allen.
Und dieser einzigartige Noir-Fall eines film Noir erinnert uns daran, dass gefälschte Beweise durchaus zu einer wahren Aussage führen können: Ein Paradox, über das man länger nachdenken kann.
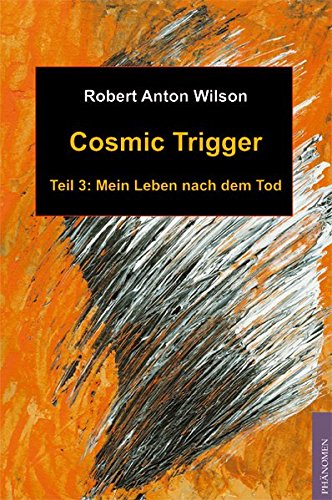
Ein informationshaltiges Environment
ist erschienen in Cosmic Trigger 3: Mein Leben nach dem Tod (2007) von Robert Anton Wilson, im Original „Magic & Marijuana in a Touch of Evil“ in Cosmic Trigger III: My Life After Death (1995)
Vielen Dank an den Phänomen Verlag für die Nutzungsgenehmigung!
